
Der Zürichsee ist mehr als nur ein landschaftliches Juwel – er ist ein Kraftort für Ideen, Stil und Innovation. Vier Persönlichkeiten setzen mit ihrer Kreativität, ihrem unternehmerischen Gespür und gestalterischer Präzision neue Massstäbe. Sie schaffen mit ihren Visionen bleibende Werte – kulturell, kulinarisch, künstlerisch und architektonisch.
Text: Beat Frei | Fotos: zvg

Claudio Tessa, Goldschmiedemeister aus Lachen SZ, verbindet traditionelle Handwerkskunst mit zeitgenössischer Formensprache. Seine Schmuckstücke sind Ausdruck von Charakter – fein gearbeitet, klar im Design und immer mit einer persönlichen Note versehen.
Was hat Sie persönlich dazu bewegt, Goldschmied zu werden – war es eine Leidenschaft für Edelmetalle, Design oder etwas ganz anderes?
Ich habe schon als Kind unglaublich gern gezeichnet, gebaut, Dinge umgestaltet oder einfach kreativ gewerkelt. Das gestalterische Arbeiten hat mich immer begleitet. Dass es den Beruf des Goldschmieds überhaupt gibt, wusste ich lange gar nicht – bis ich einmal eine Schmuckwerbung gesehen habe, auf der ein Werkbank mit feinen Werkzeugen zu sehen war. Da war es plötzlich klar: Das ist es! Nicht nur der Schmuck, sondern vor allem das Handwerk dahinter hat mich sofort fasziniert.
Wie entsteht ein Schmuckstück bei Ihnen – vom ersten Funken der Idee bis zum fertigen Werk im Schaufenster?
Oft kommen Kundinnen und Kunden mit einer Idee zu uns – und dann geht es darum, diese Idee gemeinsam zu fühlen und umzusetzen. Bei unseren Kreationen steht häufig ein besonderer Edelstein im Mittelpunkt. Oder eine Idee begleitet mich so lange im Kopf, bis sie endlich aufs Papier kommt und dann Stück für Stück in Edelmetall umgesetzt wird. Was ich besonders spannend finde, ist zu sehen, wie unsere Entwürfe bei den Menschen ankommen. Manche Designs fallen sofort auf, andere brauchen Zeit – manchmal sogar Jahre –, bis genau der richtige Moment gekommen ist.
Welche Bedeutung hat echtes Handwerk heute noch in einer Zeit, in der vieles maschinell oder digital produziert wird?
CAD ist auch bei uns auf dem Vormarsch und es eröffnen sich wirklich spannende neue Möglichkeiten. In der Regel werden CAD-Entwürfe gegossen, das heisst, man kann ein Schmuckstück auch mehrfach produzieren. Der Unterschied ist aber sichtbar – das Gefüge ist eher porös und weich und man erkennt oft den Herstellungsprozess. Wir arbeiten dagegen noch ganz traditionell: Wir schmieden unsere Schmuckstücke komplett von Hand. Dadurch entsteht ein viel dichteres, härteres Gefüge, die Konturen sind klarer und straffer. Und das spürt und sieht man einfach. Die Nachfrage nach echtem, handgemachtem Schmuck ist nach wie vor gross – wir merken immer wieder, wie sehr unsere Kundinnen und Kunden genau das schätzen. Unsere Leidenschaft für Formen, Materialien und traditionelle Techniken springt über!
Was war das emotionalste oder speziellste Schmuckstück, das Sie je anfertigen durften – und was steckt für eine Geschichte dahinter?
Emotional wird’s eigentlich immer dann, wenn wir ein geerbtes Schmuckstück umgestalten dürfen – zum Beispiel etwas von einem verstorbenen Menschen oder ein Stück voller Erinnerungen. Daraus dann etwas Neues zu kreieren, welches die Person täglich bei sich trägt, ist etwas ganz Besonderes. In solchen Momenten tauchen wir tief in die Geschichten und Emotionen ein und versuchen, all das in einem neuen Lieblingsstück zu vereinen. Das berührt uns auch selbst – es ist ein grosses Geschenk, Teil solcher Geschichten sein zu dürfen. Dann gibt’s natürlich auch die besonderen Herausforderungen – wie zum Beispiel einen voll funktionsfähigen Autoschlüssel aus Gold für einen Bentley zu fertigen oder eine Gürtelschnalle mit Familienwappen. Solche Projekte machen richtig Spass, weil wir da unsere Grenzen testen können – technisch und kreativ. Genau das lieben wir an unserem Beruf.
Wie unterscheiden Sie sich mit Ihrem Atelier von grossen Juwelierketten – was bekommt man bei Ihnen, was es dort nicht gibt?
Beim Juwelier kauft man oft einfach das fertige Schmuckstück – oder man wartet ein paar Wochen, bis es angefertigt wurde. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Wir binden unsere Kundinnen und Kunden aktiv in den Prozess mit ein. Wir hören genau zu, setzen ihre Ideen in Designs um und gestalten gemeinsam Schritt für Schritt ihr persönliches Schmuckstück. Das heisst: Wir laden sie auch während der Fertigung immer wieder ein, sich das Stück anzuschauen, mit uns abzugleichen, ob alles passt – ob wir auf dem richtigen Weg sind. So entsteht nicht einfach nur ein Schmuckstück, sondern ein echtes gemeinsames Projekt. Der Kunde erlebt sein ganz eigenes kleines Abenteuer – von der ersten Idee bis zum fertigen Ring am Finger.
Wie gehen Sie mit den Materialien um – insbesondere mit Gold, das oft mit ethischen Fragen rund um Herkunft und Nachhaltigkeit verbunden ist?
Das Thema Ethik bei Edelmetallen und Edelsteinen war für mich schon immer wichtig. Die Herkunft und die Abbaumethoden haben für mich von Anfang an eine grosse Rolle gespielt. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein auch bei unseren Kundinnen und Kunden spürbar gestiegen – viele fragen ganz gezielt nach, woher die Materialien stammen. Wir arbeiten deshalb ausschliesslich mit recyceltem Edelmetall. Bei den Edelsteinen kennen wir in manchen Fällen sogar die Minenbesitzer und ihre Familien persönlich. So können wir ein gutes Stück Transparenz und Nachvollziehbarkeit garantieren – was uns sehr wichtig ist. Natürlich ist das nicht in allen Bereichen gleich möglich – bei Diamanten zum Beispiel ist es deutlich schwieriger. Aber auch da haben wir eine Auswahl an Steinen mit Herkunftsnachweis, zum Beispiel aus Kanada oder Australien.
Gibt es Schmucktrends, die sich im Laufe der Jahre besonders stark verändert haben? Und woran erkennt man einen zeitlosen Klassiker?
Ein Klassiker ist für mich ein Schmuckstück, welches man einfach immer tragen kann – unabhängig von Moden oder Trends. Es ist moderesistent, passt zu allem, oft schlicht gehalten und eher farbneutral.
Trends im Schmuck ähneln denen in der Mode, aber sie entwickeln sich meistens etwas langsamer. Es kommt aber auch vor, dass wir ein Stück entwerfen und fertigen – und im Schaufenster interessiert sich erstmal niemand dafür. Dann, manchmal Jahre später, wollen es plötzlich alle auf einmal. Dann merken wir: Wir waren dem Trend wohl ein Stück voraus. Aktuell beobachten wir, dass der Schmuck wieder etwas filigraner wird – ich denke, das hat auch mit dem hohen Goldpreis zu tun. Verständlich, aber bei einem kleinen, feinen Stück aus ein paar Gramm Gold ist das am Ende nicht immer entscheidend.
Wie viel Technik steckt heute im Beruf des Goldschmieds – braucht es eher ruhige Hände oder auch digitales Know-how?
Ganz klar: beides! Der Goldschmied oder die Goldschmiedin von heute ist richtig multifunktional unterwegs. Es braucht die ruhige Hand und das technische Können am Werktisch – das klassische Handwerk eben. Gleichzeitig gehört aber auch das Zeichnen dazu, ob auf Papier oder Tablet, der Umgang mit CAD, ein bisschen Social-Media-Know-how und nicht zuletzt: der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. Da geht’s nicht nur ums Verkaufen, sondern auch um Freude, Empathie und Fachwissen – man muss das ganze Berufsfeld verstehen und erklären können. Im Grunde ist es heute ein spannender Mix aus traditionellem Handwerk und allen digitalen Komponenten, die unsere Zeit so mit sich bringt.
Was würden Sie jungen Menschen sagen, die sich für diesen Beruf interessieren, aber vielleicht unsicher sind, ob er «zukunftsfähig» ist?
Ich glaube, die Zukunftsfähigkeit hängt weniger vom Beruf selbst ab, sondern viel mehr davon, mit wie viel Freude und Leidenschaft man ihn ausübt. Wenn man wirklich spürt, dass es das Richtige ist, dann kommt der Erfolg meistens ganz von allein. Gerade das Handwerk – das wird immer gefragt sein. Es braucht Menschen, die mit Herz und Können arbeiten – dann hat auch das Handwerk ganz klar eine Zukunft.
Wenn Sie selbst ein Schmuckstück wären – was wären Sie und warum?
Als Frau wäre ich ganz klar ein Collier – mit Perlen aus Fiji oder Marutea. Diese Perlen haben so viel Ausstrahlung und Tiefe, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Dass ein Tier solche Kostbarkeiten hervorbringen kann, ist doch eigentlich ein kleines Wunder. Und als Mann? Da sehe ich mich eher in einem Ring – gefertigt in der Mokume-Gane-Technik. Die Herstellung ist sehr anspruchsvoll, da muss beim Schmieden wirklich alles passen: sauberes, präzises Arbeiten, aber auch eine gewisse Flexibilität. Das Spannende daran ist, dass das Ergebnis oft ganz anders wird als geplant – aber genau das macht den Reiz aus.

Ivo Raess, Teilhaber und Geschäftsführer von «FoRMS» in Freienbach, denkt Räume neu. Unter einem architektonischen Dach vereint «FoRMS»-Outdoor-Design, Kunst, Fahrzeuge, Events und Café – ein hybrides Konzept, das Erlebnis, Funktion und Ästhetik verbindet.
Herr Raess, Sie haben die Hauser Design AG erfolgreich geführt, die Firma nun mit zwei Partnern übernommen und als FoRMS AG neu positioniert – was bedeutet dieser Schritt für Sie persönlich, was soll er nach aussen ausstrahlen und welche Rolle spielen Ihre neuen Geschäftspartner?
Der Schritt zur FoRMS AG ist für mich mehr als nur eine neue Firmierung – es ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Vision. Mit meinen beiden Partnern bringen wir neue Energie, Expertise und Perspektiven ein. Wir wollen mehr sein als ein Outdoor-Spezialist: ein kuratierter Lifestyle-Ort, der Emotionen weckt und Menschen begeistert. Der Showroom soll inspirieren, unser Garten ist Bühne und Begegnungsraum zugleich.
Die FoRMS AG bleibt ihren Wurzeln im Bereich Gartenausstattung treu – aber denken Sie auch über eine Erweiterung in Richtung Interior Design oder ganzheitliche Wohnkonzepte nach?
Wir gestalten Räume, in denen Menschen leben – drinnen wie draussen. Unser Fokus liegt auf dem Übergang: dem Outdoor-Wohnzimmer, das nahtlos in die Natur übergeht. Ganzheitliche Konzepte, die Architektur, Möblierung und Atmosphäre verbinden, sind für uns der nächste logische Schritt.
Sie sind Partnerschaften mit Schmohl und Mövenpick eingegangen – und ebenso soll FoRMS AG eine Plattform für Künstler sein. Können Sie uns hierzu die Gründe und das Ziel der Partnerschaften erklären?
Wir wollen inspirieren und begeistern. Die Partnerschaften mit Marken wie Schmohl oder Mövenpick ermöglichen uns, weitere Facetten des gehobenen Lebensstils zu zeigen und gezielt Bedürfnisse zu wecken. Gleichzeitig entstehen Synergien, weil wir dieselbe Zielgruppe ansprechen. Mit Kunst und Kultur schaffen wir zudem Relevanz – FoRMS wird zu einem Ort der Begegnung und Inspiration.
Welches Lebensgefühl soll FoRMS künftig verkörpern? Geht es nur um Design oder auch um ein bestimmtes Verständnis von Lebensqualität und Ästhetik?
Es geht um ein ganzheitliches Lebensgefühl – Design ist nur ein Teil davon. FoRMS steht für Entschleunigung, Qualität, Authentizität. Für Räume, in denen man aufatmen kann. Für Ästhetik, die berührt. Unser Ziel ist, Erlebnisse zu gestalten.
Wer ist Ihre Zielkundschaft heute – und wen möchten Sie in Zukunft noch stärker ansprechen? Denken Sie eher an exklusive Individualkunden oder an eine breitere, designaffine Käuferschaft?
Unsere Kund:innen sind Individualisten mit Anspruch – Unternehmer, Architekten, Ästheten. Menschen, die den Outdoor-Lifestyle leben und Qualität schätzen. Wir möchten diese Zielgruppe weiter vertiefen, nicht verwässern. Dazu gehören auch Innenarchitekten, Gartenplaner oder Projektentwickler, mit denen wir gemeinsam Konzepte realisieren.
Ihr beruflicher Hintergrund liegt auch im gehobenen Einzelhandel, etwa bei Globus – wie prägt diese Erfahrung Ihre unternehmerische Herangehensweise bei FoRMS?
Sehr stark. Ich habe gelernt, dass Service, Storytelling und Präsentation entscheidend sind. Das Einkaufserlebnis beginnt weit vor dem Kauf und endet nicht beim Lieferschein. Für mich ist FoRMS ein Gastgeber. Wir schaffen ein Erlebnis, das inspiriert, berührt und bleibt.
Was ist für Sie gutes Design? Gibt es bestimmte Werte oder Prinzipien, die in jedem Produkt von FoRMS spürbar sein sollen?
Gutes Design ist funktional, zeitlos, ehrlich – und es macht Freude. Es begleitet den Alltag, ohne sich aufzudrängen. Unsere Produkte sollen Bestand haben, unabhängig von Trends. Qualität, Materialität und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum.
Die Zeiten ändern sich: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, veränderte Konsumgewohnheiten – wie reagieren Sie mit FoRMS auf diese Herausforderungen und Chancen?
Wir sehen Digitalisierung als Chance zur Vertiefung der Beziehung – nicht als Ersatz. Unsere neue Website, der Online-Shop und die digitale Beratung sind so gestaltet, dass sie inspirieren und Orientierung geben. Nachhaltigkeit ist für uns kein Add-on, sondern Voraussetzung: langlebige Produkte, kurze Wege, verantwortungsvolle Prozesse.
In einer zunehmend schnelllebigen Welt: Welche Rolle spielt der Garten heute noch – und wie kann FoRMS den Menschen helfen, diesen Ort wieder wertzuschätzen?
Der Garten ist das neue Wohnzimmer – ein Rückzugsort, der gleichzeitig Status und Selbstverständnis ausdrückt. Bei FoRMS kuratieren wir Räume, die zur Persönlichkeit passen. Mit Qualität, Atmosphäre und dem Gespür für das richtige Zusammenspiel aller Elemente helfen wir, diesen Ort neu zu entdecken und zu schätzen.
Viele Menschen interessieren sich für Design, trauen sich aber nicht, selbst zu gestalten. Bietet FoRMS Beratung oder Begleitung über den Produktverkauf hinaus?
Absolut. Wir verstehen uns als Gestaltungsbegleiter. Wir hören zu, erkennen Wünsche und entwickeln gemeinsam Lösungen – der persönliche Aspekt ist für uns wichtig, um Lösungen zu schaffen, welche auf die individuellen Wünsche zugeschnitten sind und langfristig zufrieden stellen.
Wenn Sie in zehn Jahren auf FoRMS zurückblicken: Was wäre für Sie der schönste Beweis dafür, dass Sie mit Ihrem Team den richtigen Weg gegangen sind?
Wenn Kunden, Mitarbeitende und Partner sagen: «Wir sind Teil von etwas Besonderem.» Wenn Vertrauen, Kontinuität und Begeisterung spürbar sind – dann haben wir unser Ziel erreicht. FoRMS soll ein Ort sein, der inspiriert, verbindet und nachhaltig wirkt.

Elios Elsener, Inhaber des neuen «Chez Fritz» in Kilchberg, haucht einer historischen Adresse neues Leben ein. Mit frischer Küche, stilvollem Ambiente und unaufgeregter Gastfreundschaft schafft er einen Ort für Geniesser und Entdecker.
Herr Elsener, vom Banker zum Gastwirt – was war der Schlüsselmoment, der Sie dazu bewogen hat, das traditionsreiche Chez Fritz selbst in die Hand zu nehmen?
Der Gedanke hat mich schon sehr lange begleitet. Jedes Mal, wenn wir auf Reisen waren und schöne Gastronomiekonzepte erleben durften, wurde dieser Wunsch grösser. Ich habe das Leben als Banker sehr genossen, wollte aber den Schritt zum Unternehmer vor meinem 50. Lebensjahr wagen, das habe ich nun geschafft. Neben dem Restaurant bin ich zudem Partner bei einem KMU in der Medienbranche.
Welche Erfahrungen aus Ihrer Zeit im Finanzsektor helfen Ihnen heute beim Führen eines Restaurants – und wo mussten Sie komplett neu lernen?
Ich bin gewohnt, mit Zahlen zu arbeiten und Business Cases zu beurteilen. Das Budget hatten wir schon sehr früh zusammen und nutzen dieses auch konsequent bei der Umsetzung. Zudem war ich die letzten sieben Jahre meiner Finanzkarriere im Firmenkundengeschäft der Credit Suisse tätig, welche das Unternehmertum stets im Fokus hatte. Überrascht und ehrlich gesagt sogar schockiert war ich über das Verhalten von Mitarbeitenden. Noch nie vorher hatte ich Arbeitsverträge ausgestellt mit rechtsgültigen Unterschriften, welche nach wenigen Wochen bereits wieder zurückgezogen wurden. Teilweise sind Kandidaten einfach untergetaucht.
Chez Fritz liegt traumhaft am Zürichsee – aber Lage allein macht noch keinen Erfolg. Was ist Ihre Vision für das neue Chez Fritz?
Wir wollten einen Ort schaffen, der an die Riviera Beach Clubs der 60er-Jahre erinnert und wo Casual-Fine-Dining gelebt wird. Wir werden auch 60–70 % der Speisekarte mit Fischgerichten anbieten, da wir überzeugt sind, dass unsere Gäste dies schätzen werden.
Wie sehr war die Wiedereröffnung für Sie eine Herzensangelegenheit – und wie stark ein Business-Entscheid?
Diese Frage kann ich einfach beantworten. Es ist eine Herzensangelegenheit mit dem Bewusstsein, dass es nicht einfacher geworden ist, mit einem Restaurant Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite haben wir uns bereits früh mit den Finanzen auseinandergesetzt und realisiert, dass dieses Projekt auch aus einer Business-Optik interessant sein kann.
Die Gastronomie verändert sich rasant: Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Personalmangel. Was ist für Sie die grösste Herausforderung – und wie gehen Sie sie an?
Die grösste Herausforderung ist definitiv der Personalmangel. Wir arbeiten mit Stellenvermittlungsplattformen zusammen und nutzen gleichzeitig neue Kanäle wie die sozialen Medien. Aus meiner Sicht fehlt es in der Gastronomie zum Teil an Professionalität im Rekrutierungsprozess. Ich habe jede Bewerbung geprüft, Kandidatinnen zu Video- oder persönlichen Interviews eingeladen und jede Bewerbung mit Begründung beantwortet. Kandidatinnen waren über diese Art oftmals überrascht. Viele Kandidatinnen sind dann auch über persönliche Empfehlungen an uns weitergeleitet worden. In der Digitalisierung müssen wir noch ein paar Schritte machen. Die Möglichkeiten sind da, leider ist aber auch die Systemkomplexität nicht zu unterschätzen.
Wie unterscheidet sich der heutige Gast von dem, der vor 20 Jahren ins Chez Fritz kam? Was ist ihm heute wichtiger?
Die Gäste sind ungeduldiger geworden. Sei es in Bezug auf die Uhrzeit oder das Angebot. Der moderne Gast will ein breites Angebot, in guter Qualität, zu fairen Preisen und das alles in einem ansprechenden Rahmen. Immer wichtiger werden die Themen vegane Küche, nachhaltige Produkte, non-alkoholische Getränke und Umgang mit Allergien.
Viele träumen davon, ein eigenes Restaurant zu führen – Sie tun es. Was sind die grössten Illusionen, die man sich macht, bevor man startet?
Das Eröffnen eines Restaurants würde ich am ehesten mit einem Marathon vergleichen. Die Vorbereitungsphase ist sehr anspruchsvoll und ressourcenintensiv. Wer glaubt, dass es damit gemacht ist, täuscht sich gewaltig. Der Lauf ist genauso anspruchsvoll und das Feedback über die Performance bekommt man sofort, sei es direkt am Tisch oder danach per Rezensionen und Ratings. Wir sind noch mitten im Lauf und haben ein langes Rennen vor uns.
Was war die Inspiration für das neue Chez Fritz und was wird noch folgen?
Wir wollten einen Ort schaffen, wo sich sowohl Kilchberger, aber auch Touristen aus aller Welt wohlfühlen. Nach einer heissen und intensiven Anfangsphase haben wir den Betrieb stabilisiert. Wir haben auch bereits einen Sonntags-Event mit über 250 Gästen organisiert, weitere werden folgen. Mit unserem Geschäftsführer Lukas Schrottenbaum sind wir bereits an interessanten Themen dran.
Was wünschen Sie sich, wenn man in fünf Jahren an Chez Fritz denkt? Wofür soll es dann stehen?
Ich wünsche mir zufriedene, wiederkehrende Gäste, welche unser Angebot schätzen und sich bei uns wohlfühlen. Wir wollen die über 60 Jahre alte Geschichte des Chez Fritz weiterschreiben.
Und zum Schluss: Welche Frage über Ihren Berufswechsel oder die Gastronomie bekommen Sie privat am häufigsten gestellt – und was antworten Sie darauf?
Die meistgestellte Frage ist jene, ob ich die Bank nicht vermissen würde. Hier kann ich generell antworten, dass es für meinen jetzigen Lebensabschnitt fantastisch ist, mich unternehmerischen Projekten zu widmen. Daher nein, ich vermisse die Bank nicht, aber bin sehr dankbar für die lehrreiche Zeit und die vielen Freundschaften, die sich daraus ergeben haben.
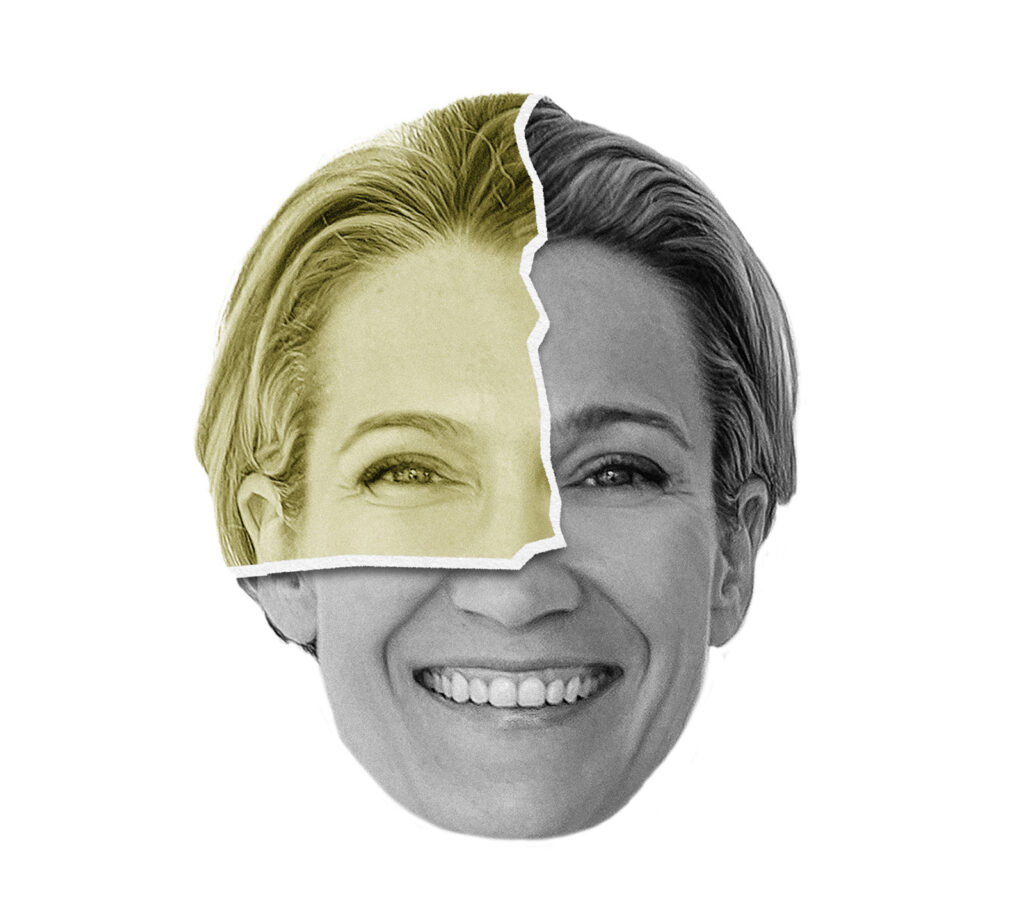
Ina Rinderknecht, renommierte Innenarchitektin aus Erlenbach, ist international gefragt für ihre stilsicheren, atmosphärischen Raumkonzepte. Ihre Projekte reichen von luxuriösen Wohnkonzepten bis zu Hospitality-Design auf höchstem Niveau.
Frau Rinderknecht, Sie gestalten Hotels und Gastronomiebetriebe auf der ganzen Welt – wie schafft man es, internationale Designstandards mit der individuellen Handschrift eines Hauses zu vereinen?
Bei all unseren Projekten steht der Kunde mit seinen individuellen Wünschen im Mittelpunkt. Internationale Designstandards spielen dabei eine untergeordnete Rolle – wenn überhaupt –, denn unser Anspruch ist, vollständig massgeschneiderte Interior-Konzepte zu entwickeln. Unsere Vision entsteht stets im Zusammenspiel aus den Bedürfnissen des Kunden, der Architektur und dem jeweiligen Standort. Bereits in der frühen Planungsphase integrieren wir gezielt Elemente wie Kunst und andere gestalterische Einflüsse. So entstehen einzigartige Häuser, Restaurants und Hotels mit unverwechselbarem Charakter.
Wenn ein Kunde zu Ihnen kommt: Was ist das Erste, das Sie über ihn oder sein Projekt wissen möchten – und warum?
Der Ablauf eines Projekts folgt bei uns einer klar definierten Struktur. Am Anfang steht immer die sorgfältige Ermittlung der Bedürfnisse. Dabei entstehen zahlreiche zentrale Fragen – etwa: Wie lebt ein privater Kunde? Welche funktionalen Anforderungen stellt er an sein Zuhause? Ähnliche Überlegungen gelten selbstverständlich auch für Hotels oder Restaurants. Erst wenn diese grundlegenden Aspekte geklärt sind, widmen wir uns der atmosphärischen Gestaltung des Interiors. So stellen wir sicher, dass Design und Funktionalität im Einklang stehen.
Innenarchitektur gilt oft als «unsichtbare Kunst» – man spürt, wenn sie gelungen ist, aber erkennt nicht immer die Details. Was sind für Sie die unsichtbaren Zutaten eines erfolgreichen Projekts?
Tatsächlich spürt man, dass ein Interior gut ist, ohne sofort erklären zu können, warum. Auch wenn ich gern sage: «It’s magic», steckt natürlich keine Zauberei dahinter – sondern viel harte Arbeit und eine klare gestalterische Strategie. Ein gelungenes Interior ist das Ergebnis vieler präzise durchdachter Details, die zu einem stimmigen Gesamterlebnis verschmelzen. Am Anfang steht die strukturierte Planung: die räumliche Organisation, das Möbellayout, die Materialwahl, Farbgestaltung und nicht zuletzt das richtige Licht. Entscheidend ist zudem, dass das Interior zum Ort passt und sich sensibel in den lokalen Kontext einfügt. Leider kann selbst ein gutes Konzept schnell aus dem Gleichgewicht geraten – etwa durch unpassend gewählte Accessoires oder Kunstobjekte, die ohne gestalterisches Feingefühl ergänzt werden. Dann entsteht eine Disharmonie, die man oft unmittelbar wahrnimmt.
Wie gehen Sie mit Situationen um, in denen der Geschmack des Kunden nicht mit Ihrem gestalterischen Empfinden übereinstimmt?
Am Ende dreht sich alles um Kommunikation und den richtigen Austausch. Wir arbeiten grundsätzlich nur an Projekten, bei denen sich die Vision des Kunden mit unserer gestalterischen Handschrift vereinen lässt. Meist haben sich die Kunden bereits im Vorfeld intensiv damit auseinandergesetzt, mit wem sie zusammenarbeiten möchten, und sich dann für uns entschieden. Entscheidender als alles andere ist deshalb ein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen. Auch bei unterschiedlichen Meinungen ist ein offener, konstruktiver Dialog essenziell. Ich sage bewusst Nein, wenn eine Idee nicht zum Charakter des Projekts passt – denn nur so bleibt die gestalterische Integrität gewahrt. Alles andere ist verhandelbar.
Kreativität und Budget: ein ewiger Tanz oder eher ein lösbares Puzzle? Wie oft sind Kompromisse nötig – und wie elegant lassen sie sich ins Design integrieren?
Wie Sie sagen, geht es in unserem Beruf um Kreativität – und das bedeutet, flexibel und neugierig zu bleiben. Innerhalb des gegebenen Budgets suchen wir immer nach der besten Lösung. Was für mich allerdings nicht funktioniert, ist der Versuch, ein hochwertiges Interior zu schaffen und es dann mit günstigen Materialien oder Imitaten zu verwässern. Da steige ich aus – denn für mich muss ein Interior ehrlich und authentisch sein. Es soll nicht so tun, als wäre es etwas anderes. Das ist für mich vergleichbar mit dem Tragen einer gefälschten Uhr oder Tasche – man sieht es einfach. Stattdessen plädiere ich dafür, ein Interior von Anfang an dem Budget entsprechend zu planen, ohne auf unechte Kompromisse zurückzugreifen. Authentizität ist immer eleganter als eine schlecht gemachte Imitation.
Gibt es ein Projekt, bei dem Sie rückblickend sagen: Da haben wir etwas erschaffen, das nicht nur schön, sondern auch bedeutsam ist?
Jedes Projekt ist für uns bedeutsam, denn es spiegelt – auf tiefer Ebene – immer auch das Wesen des Kunden wider. Allein das macht unsere Arbeit unglaublich wertvoll. Bei historischen Gebäuden sehe ich es als unsere Aufgabe, die Geschichte zu bewahren und das Interior mit Feingefühl in die Gegenwart zu übersetzen. So durften wir zum Beispiel im Art-Déco-Hotel Montana in Luzern die historischen Räume behutsam in die heutige Zeit überführen – ohne dabei die Seele des Hauses zu verlieren. Bei Projekten wie dem Familienbetrieb Chez Fritz in Kilchberg geht es um die respektvolle Weiterführung einer Familientradition – auch das ist ein Akt der Wertschätzung und Gestaltung mit Verantwortung. Und in privaten Wohnhäusern gestalten wir Räume des Wohlfühlens, Rückzugs und der Identität – Orte, die nicht nur schön, sondern auch bedeutsam sind.
Sie arbeiten mit Farben, Licht, Materialien – aber auch mit Emotionen. Was muss ein Raum bei Ihnen «können», damit er mehr ist als nur ästhetisch?
Die Grundlage jedes Projekts ist seine Funktionalität – sie ist das A und O für ein gelungenes Ergebnis. Unsere Arbeit basiert darauf, funktionale Lösungen zu schaffen, die sich nahtlos in den Alltag integrieren. Materialien und Farben unterstützen dabei, Emotionen zu transportieren und eine Atmosphäre des Wohlbefindens zu erzeugen. Räume müssen mehr leisten, als nur ästhetisch zu wirken. Farben und Materialien tragen entscheidend zur Atmosphäre bei – sie beeinflussen unser Wohlbefinden, unsere Konzentration und sogar unser Verhalten. Ein gut gestalteter Raum schafft nicht nur visuelle Reize, sondern unterstützt auch funktionale Abläufe, fördert Kommunikation oder bietet Rückzugsmöglichkeiten – je nach Nutzungskontext. Es geht darum, eine Balance zu schaffen zwischen visueller Harmonie, emotionaler Wirkung und praktischer Alltagstauglichkeit.
Innenarchitektur verändert sich – durch Nachhaltigkeit, Technologie und neue Lebensstile. Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Berufs und worauf freuen Sie sich besonders?
Wie in vielen Berufen befinden auch wir uns in einem ständigen Entwicklungsprozess. Neue Technologien fliessen kontinuierlich in unsere Arbeit ein – sowohl in unsere Arbeitsweise als auch in die Immobilien selbst. Das Schöne an unserem Beruf ist jedoch: Sein Kern bleibt erhalten. Wir arbeiten weiterhin mit physischen Materialien, mit echten Räumen, echten Oberflächen. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt gewinnt die handwerkliche Qualität und der Wert des Analogen an Bedeutung. Es geht dabei immer um Balance – zwischen Innovation und Tradition, zwischen globalen Möglichkeiten und regionaler Identität. Durch unsere enge Verbindung zur Welt schöpfen wir aus einer Vielzahl an Einflüssen, gleichzeitig wächst das Bewusstsein für lokale Ressourcen und regionale Werte. Beides ergänzt sich auf eine sehr bereichernde Weise.
Gibt es ein bestimmtes Material, einen Stil oder eine Designphilosophie, die Sie derzeit besonders fasziniert – und warum?
Grundsätzlich lege ich grossen Wert auf hochwertige Materialien und die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die eine klare Haltung und gestalterische Kultur mitbringen. Daraus entstehen immer wieder spannende Kooperationen – wie zum Beispiel mit Schotten & Hansen, die mit ihren aussergewöhnlichen Holzböden und Furnieren nicht nur nachhaltig produzieren, sondern auch mit innovativen Ideen überzeugen. Gemeinsam haben wir eine Kollektion farbiger Holzfurniere entwickelt, die vielseitig einsetzbar ist und durch ihre besondere Haptik und Materialität bereits für sich spricht. Neben Holz arbeite ich auch gerne mit Natursteinen und edlen Stoffen – Materialien, die eine starke Präsenz haben und Räume mit Tiefe und Charakter füllen.
Wenn Sie jungen Menschen erklären müssten, was an Ihrem Beruf nach all den Jahren immer noch Freude macht – was würden Sie sagen?
Für mich ist Innenarchitektur mehr Berufung als Beruf. Mit jedem Projekt wachse ich – fachlich ebenso wie menschlich. Die Arbeit ist vielseitig: Ich bin Gestalterin, Unternehmerin und gleichzeitig Vertrauensperson für Kunden und Mitarbeitende. Genau diese Kombination macht meinen Alltag so spannend. Kein Projekt gleicht dem anderen und jeder Kunde bringt neue Perspektiven mit. Unsere Arbeit kennt keine geografischen Grenzen – wir realisieren Projekte weltweit und arbeiten mit Kunden und Partnern über Landesgrenzen hinweg. Diese internationale Zusammenarbeit ist nicht nur bereichernd, sondern eröffnet immer wieder neue Perspektiven. Jedes Projekt bringt kulturelle, ästhetische und funktionale Impulse mit sich, die unsere Arbeit inspirieren und weiterentwickeln. Diese Vielfalt sorgt dafür, dass der Beruf nie an Reiz verliert.